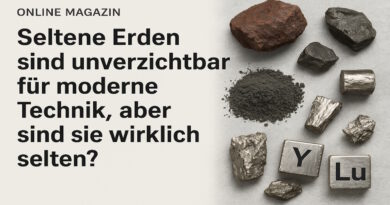Die Energiespeicher für effiziente Erneuerbare Energie
Bei der Sektorenkopplung und der Steigerung der Effizienz von Erneuerbaren Energien (EE) spielen Energiespeicher die größte Rolle. Hierbei geht es darum, die durch EE gewonnene elektrische Energie effizient mittels Power-to-X-Technologien (PtX) zu speichern.
Erneuerbare Energien produzieren nicht immer nur dann Strom, wenn er auch benötigt wird. Die Speicherung der elektrischen Energie in verschiedenen Energiespeichern ermöglicht es, die Energie für den Zeitpunkt nutzbar zu machen, wenn sie gebraucht wird. Wenn momentan verfügbare elektrische Energie, die nicht benötigt wird, für die spätere Nutzung gespeichert werden kann, dann sprechen wir von einer Steigerung der Energieeffizienz von EE.
Wie wird Energie gespeichert?
Häufig geht die Speicherung der elektrischen Energie mit einer Wandlung der Energieform einher: So wird beispielsweise bei einem handelsüblichen Akkumulator (Akku, Batterie) die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Ein weiteres Beispiel wäre die Umwandlung von elektrischer Energie in potenzielle Energie bei einem Pumpspeicherkraftwerk. Sollte die gespeicherte Energie wieder benötigt werden, so kann sie dann in die gewünschte Form zurück gewandelt werden.
Dabei ist zu beachten, dass jede Energieumwandlung (Speicherung und auch Rückumwandlung) immer mit Energieverlusten einhergeht. Diese Energieverluste bei der Energieumwandlung sind meist thermische Verluste in Form von Wärmeabgaben beim Umwandlungsprozess.
Sektorenkopplung und Umwandlungstechnologien

Wie die Grafik über die Sektorenkopplung von dem Energieatlas der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, entstehen in den verschiedenen Sektoren unterschiedliche Formen der Energiespeicher: Stromspeicher, Wärmespeicher, Gasspeicher und Treibstofflager.
Hier eine Tabelle mit den Energieformen und zugehörigen Beispielen für Energiespeicher für die Verwendung in Kombination mit Erneuerbaren Energien:
| Energieform | Technologie oder Biologie |
| Thermische Energie | Wärmespeicher Fernwärmespeicher Thermochemische Wärmespeicher Latente Wärmespeicher Gasverflüssigung durch Kälte |
| Anorganische chemische Energie | Galvanische Zelle (Batterie, Akkumulator) Redox-Flow-Batterie Wasserstoff |
| Mechanische Energie – kinetisch Bewegungsenergie | Schwungradspeicher |
| Mechanische Energie – potenzielle Lageenergie | Feder Pumpspeicherkraftwerk Druckluftspeicherkraftwerk Hubspeicherkraftwerk |
| Elektrische Energie | Kondensator Supraleitender Magnetische Energiespeicher |
Die verschiedenen Energiespeicherformen können anhand der Speicherdauer kategorisiert werden. Es können dabei folgende Zeitfenster betrachtet werden:
- Ausgleich von saisonalen Unterschieden (bspw. PV-Anlagen im Winter vs. im Sommer)
- Ein bis zwei Wochen (bspw. Anhaltende Stark- oder Schwachwindperioden)
- Bis zu drei Tage (Zufallsschwankungen)
- Bis zu einem Tag (bspw. PV-Anlagen tagsüber vs. bei Nacht)
- Subsekundenbereich bis zu wenigen Minuten (Einspeisefluktuationen)
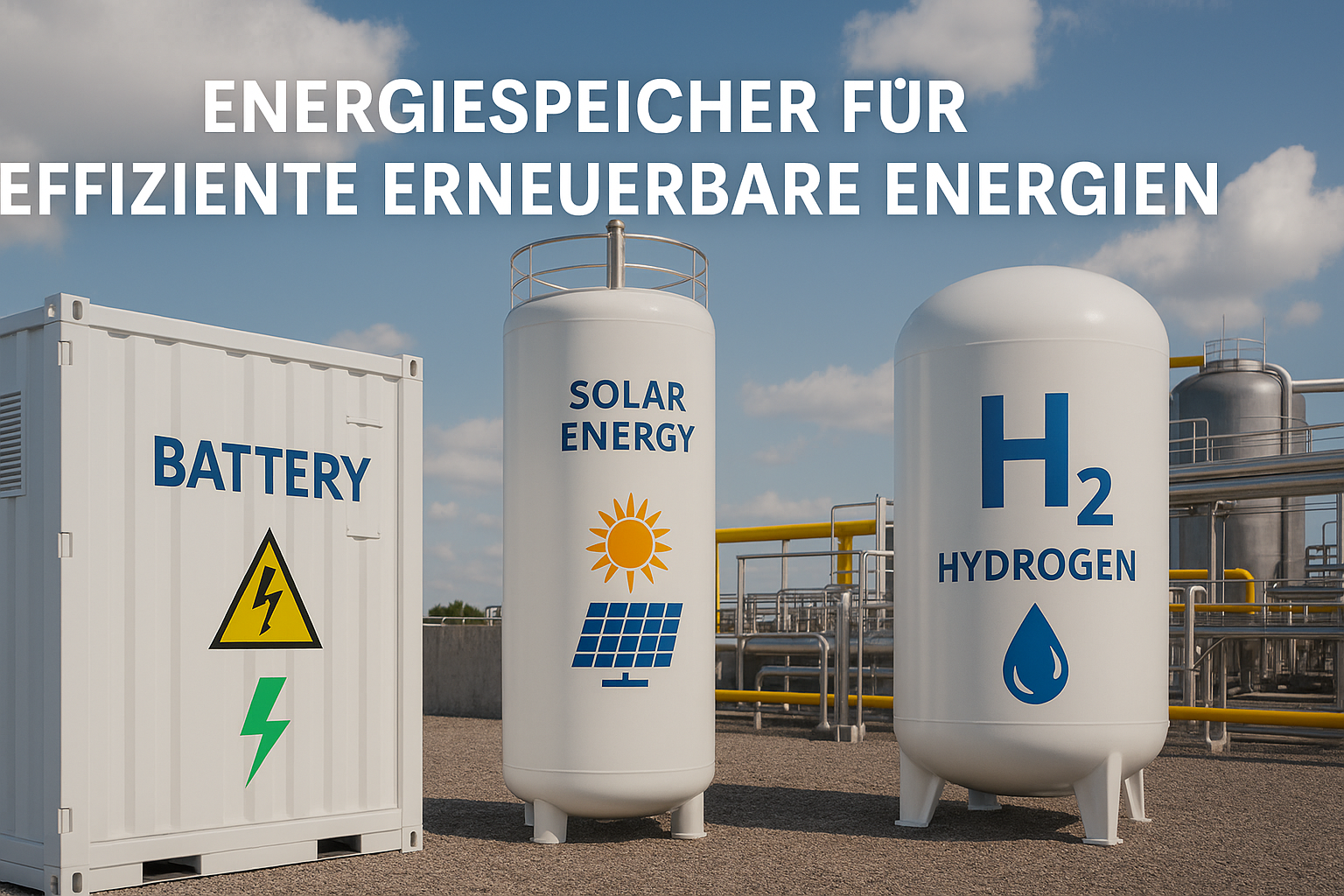
Langzeitspeicher sind dazu in der Lage, Energie über mehrere Tage oder sogar Jahre zu speichern. Das Energiespeichervermögen ist pro Leistungseinheit sehr hoch. Die Selbstentladung ist niedrig und ihr Speicherwirkungsgrad ist gering. Im Vergleich zu kurzfristigen Energiespeichern ist auch ihre Zyklenzahl niedrig. Die Zyklenzahl beschreibt die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge, die mit dem Energiespeicher vorgenommen werden können, so ähnlich wie die Lebensdauer eines Produkts.
Langzeitspeicher wären beispielsweise:
- Gasspeicher
- Sensible und latente Wärmespeicher
- Fernwärmespeicher
- Brenn- und Kraftstoffe
- Manche Pumpspeicher
Auf der anderen Seite gibt es die Kurzzeitspeicher, die die Energie für Sekundenbruchteile bis hin zu einem Tag speichern können. Die Kurzzeitspeicher haben einen hohen Speicherwirkungsgrad und besitzen hohe Zyklenzahlen. Folgende Energiespeicher werden als Kurzzeitspeicher verwendet:
- Schwungmassenspeicher (als Sekundenspeicher)
- Kondensatoren (als Sekundenspeicher)
- Spulen (als Sekundenspeicher)
- Akkumulatoren (als Minuten- bis Tagesspeicher)
- Pumpspeicher (Stunden- bis Tagesspeicher)
- Druckluftspeicher (Stunden- bis Tagesspeicher)
- Verschiedene sensible und latente Wärmespeicher (als Minuten- bis Tagesspeicher)
Die Notwendigkeit für Energiespeicher – insbesondere Langzeitenergiespeicher – wird erhöht, wenn es im Stromsystem hohe und längere Stromüberschüsse gibt. Diese sind bei einem Anteil der Erneuerbaren Energien von mindestens 60 bis 70 Prozent zu erwarten. Hierfür wären dann Stromspeichertechnologien wie die Power-to-Gas-Technologie (PtG) relevant. Zunächst ist es jedoch sinnvoll die mittels PtG gespeicherte Energie in anderen Sektoren als dem Stromsektor zu nutzen – etwa als Treibstoff im Verkehrssektor. Bei einer Umstellung des Energiesystems auf 100 Prozent Erneuerbare Energien ist die Rückverstromung des PtG-Gases der letzte Schritt.