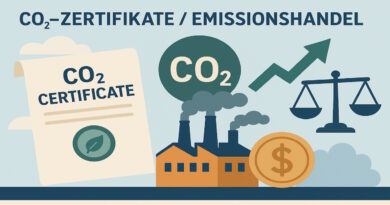Wunderwerke der Natur: Ökosysteme zur CO2-Absorption
Wie Seegraswiesen, Wälder und Moore unsere wichtigsten Verbündeten gegen die Klimakrise sind.
Klimaschutz fängt am Meeresboden an und hört im Mischwald nicht auf. Unscheinbare Lebensräume wie Seegraswiesen, artenreiche Wälder und Moore entpuppen sich als Schlüsselakteure im Kampf gegen den Klimawandel. Ihre Fähigkeit, CO2 aufzunehmen und langfristig zu speichern, macht sie zu stillen Helden der Klimapolitik.
Küstenschätze für das Klima: Seegraswiesen, Mangroven und Salzmarschen als CO2 Speicher
Seegraswiesen Mangrovenwälder und Salzmarschen sind Lebensräume entlang der Küsten und speichern jährlich bis zu 216 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre. Was sie so besonders macht, ist, dass sie den Kohlenstoff nicht nur kurzfristig in ihrer Biomasse einlagern, sondern in ihren Sedimenten über Jahrhunderte bis Jahrtausende stabile CO2 Depots bilden. Allein im Meeresboden befinden sich so bis zu 22.000 Millionen Tonnen gebundener Kohlenstoff.
Biodiversität und Klimaschutz gehen Hand in Hand
Doch das ist nur ein Teil ihrer Fähigkeiten. Marine Ökosysteme wie Mangroven und Salzmarschen schützen nicht nur das Klima, sondern auch die Küsten. Sie wirken als natürliche Barrieren gegen Sturmfluten, bewahren Landflächen vor Erosion und dienen gleichzeitig als Heim zahlreicher Meeresbewohner. Ohne diese Küstenzonen wäre das Überleben für viele Arten, aber auch für Millionen von Menschen in Küstenregionen gefährdet.
Ein Bericht des Öko-Instituts und des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung im Auftrag des Umweltbundesamtes kommt zu einem klaren Schluss. Der Schutz sogenannter Blue-Carbon Ökosysteme (Küsten- und Meereslebensräume wie Seegraswiesen, Mangrovenwälder und Salzmarschen, die große Mengen CO2 speichern) ist unerlässlich, um den Klimawandel wirksam einzudämmen.
Wie viel CO2 speichern die marinen Wunderwerke?
Die Speicherleistung dieser Ökosysteme ist beeindruckend:
- Seegraswiesen, die an fast allen Küsten in 1–3 Metern Tiefe vorkommen, speichern 75–150 Millionen Tonnen CO2 in den Pflanzen und bis zu 8.400 Millionen Tonnen in den Sedimenten.
- Mangrovenwälder, in den Tropen und Subtropen beheimatet, binden 1.200–3.900 Millionen Tonnen CO2 in ihrer Biomasse und nochmals 8.400 Millionen Tonnen im Boden.
- Salzmarschen in gemäßigten Breiten leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag mit 1.350 Millionen Tonnen gespeicherten CO2.
Hinzu kommt, dass diese Ökosysteme nicht nur ihren eigenen Kohlenstoff speichern. Sie nehmen auch Material auf, das durch Strömungen oder Flüsse eingetragen wird, etwa abgestorbene Algen oder organisches Material aus dem Landesinneren.

Artenreiche Mischwälder speichern mehr CO2 und trotzen dem Klimawandel
Auch an Land leisten Ökosysteme entscheidende Arbeit. Besonders Wälder sind wichtige Kohlenstoffsenken. Doch nicht jeder Wald ist gleich effektiv. Eine internationale Studie unter Leitung der Universität Freiburg belegt, dass Artenreiche Mischwälder deutlich mehr CO2 speichern als Wälder, die aus Monokulturen bestehen.
Im Rahmen des weltweit ältesten Experiments zur tropischen Baumvielfalt (Sardinilla-Experiment in Panama) zeigten sich klare Ergebnisse. Wälder mit fünf verschiedenen Baumarten speicherten 57 Prozent mehr Kohlenstoff in der oberirdischen Biomasse als solche mit nur einer Art. Auch die Kohlenstoffflüsse, also der Austausch zwischen Pflanzen, Boden und Atmosphäre waren deutlich intensiver.
Besonders relevant vorzumerken ist, dass diese höhere Speicherfähigkeit selbst unter Extrembedingungen wie Dürre oder Hurrikans erhalten blieb. Vielfalt macht Wälder widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. Angesichts der zunehmenden Wetterextreme ist dies ein entscheidender Vorteil gegenüber Monokulturen.
Die Kraft der Moore im Kampf gegen den Klimawandel
Extrem bedeutsam sind Moore. Sie speichern mehr Kohlenstoff als alle Wälder zusammen, obwohl sie nur rund drei Prozent der Erdoberfläche bedecken. In ihrem Torf befindet sich Kohlenstoff, der seit Jahrtausenden konserviert ist. Doch viele Moore wurden entwässert und in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt. Das hat gravierende Folgen für die Umwelt. In Deutschland stammen über 7 % der gesamten Treibhausgasemissionen aus degradierten Mooren.
Durch Wiedervernässung (das gezielte Zurückführen von Wasser in trockengelegte Moore, um deren natürliche Feuchtigkeit und CO2-Speicherfunktion wiederherzustellen) lässt sich dieser Trend umkehren. Moore können erneut zu CO2-Senken werden. Ein natürlicher Klimaschutz mit immenser Wirkung.
Grünland und gesunde Böden als wichtige Kohlenstoffspeicher
Auch extensiv genutztes Grünland und gesunde Böden haben das Potenzial, große Mengen CO2 zu speichern. Bei nachhaltiger Bewirtschaftung, etwa durch Verzicht auf Düngemittel oder Bodenschonende Bearbeitung, kann der Humusgehalt (Anteil organischer Substanz im Boden) steigen, was wiederum mehr Kohlenstoff im Boden bindet. Doch intensive Nutzung, Entwässerung und Überdüngung sind problematisch und führen zum Gegenteil.
Naturbasierte Lösungen sind überlebenswichtig
Natürliche Ökosysteme sind essenzielle Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel, egal ob unter Wasser, im Tropenwald oder im Moor. Doch ihr Potenzial wird politisch wie wirtschaftlich noch immer unterschätzt. Viele Staaten berücksichtigen etwa marine CO2-Senken nicht in ihren offiziellen Klimabilanzen und berauben sich damit eines zentralen Steuerungsinstruments.
Um das volle Potenzial natürlicher Kohlenstoffspeicher zu nutzen, braucht es gezielten Schutz, nachhaltige Nutzung und Wiederherstellung geschädigter Lebensräume. Nur dann können die Wunderwerke der Natur auch in Zukunft das leisten, was sie seit Jahrtausenden tun, nämlich das Klima stabilisieren, Leben ermöglichen und uns alle schützen.